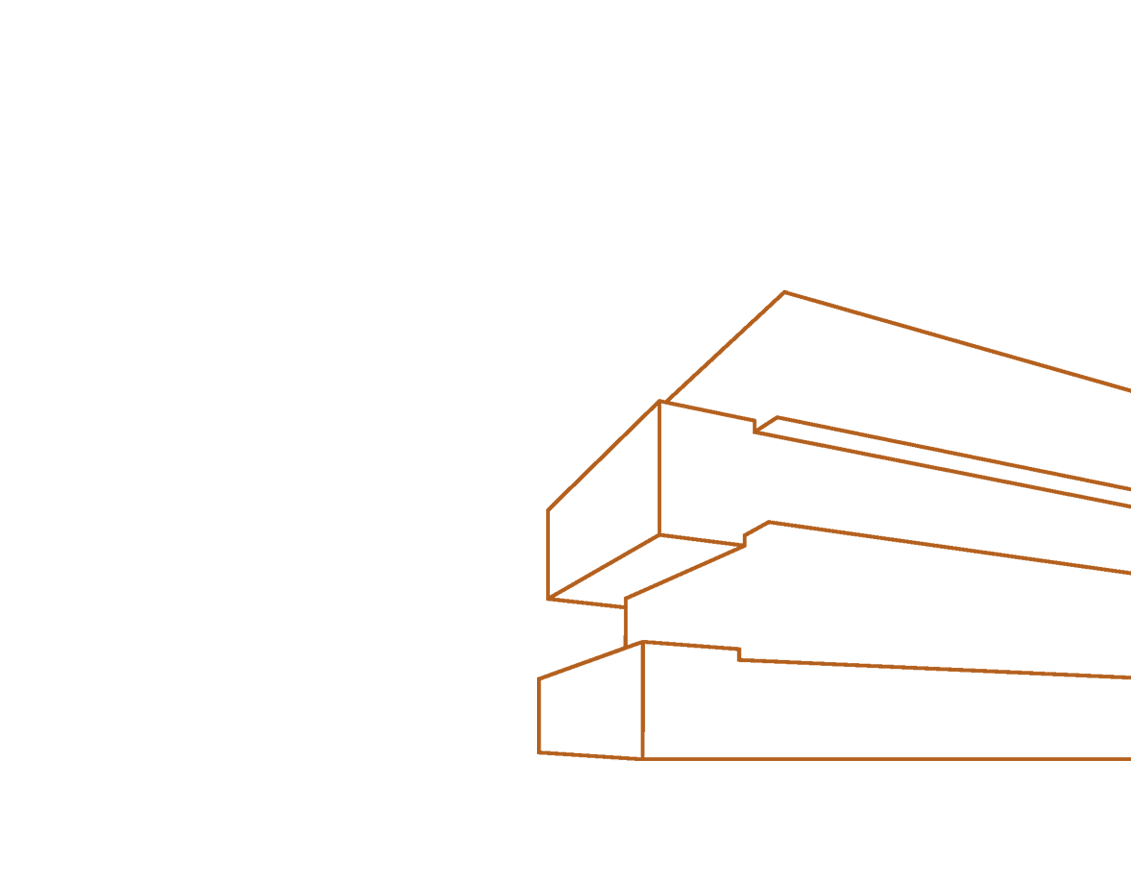IMMOBILIENMARKETING NACH DEM DIGITALEN TURN
Ein Interview mit Katrin und Hans Georg Hiller von Gaertringen (H von G) über die Digitalisierung der Immobilienbranche mit INVENTIO Projectpartner Geschäftsführer Tilo Hellinger und Sebastian Höft (Property Company)
H von G: Herr Höft, Herr Hellinger, Sie sind beide schon lange im Immobiliengeschäft – jeweils rund 20 Jahre. Richten wir zunächst den Blick einmal zurück ins analoge Zeitalter. Sind Ihnen Kürzel wie DG, EB oder GEH überhaupt noch geläufig?
Sebastian Höft: Klar. Dachgeschoss, Erstbezug, Gasetagenheizung. Das sind Abkürzungen, wie man Sie in unserer Branche früher im Immobilienteil von Zeitungen wie dem Tagesspiegel oder der Morgenpost verwendete. Als jede Zeile Geld kostete und man sich dementsprechend kurz fassen musste. Heute schmunzele ich, wenn ich daran zurückdenke. Im Netz gibt es keine Begrenzung mehr – man sollte sich aber dennoch beschränken.
Tilo Hellinger: Die Zeit, in der diese Abkürzungen zu unserem Berufsalltag gehörten, ist ja gefühlt noch gar nicht so lange her: Der Umschwung von den Printmedien zur Online-Vermarktung hat erst vor rund zwanzig Jahren angefangen, z.B. mit der Gründung von Scout24.
H von G: Was hat der Digitalisierung den ersten Schub gegeben?
TH: Zu Beginn lag der Reiz vor allem darin, dass es so günstig war. Die Print-Anzeigen, auf denen der ganze Markt zuvor basierte, waren, speziell in München, extrem teuer. Ich habe Anfang der 2000er Jahre bei einem großen Bauträger gearbeitet und wir haben jedes Jahr mehrere hunderttausend Euro für Anzeigen z. B. an die Süddeutsche Zeitung überwiesen. Das war damals das Medium, von dem in München alles abhing. Und das wusste die SZ natürlich auch.
SH: Ich erinnere mich, dass wir 1998 natürlich auch schon mit Rechnern gearbeitet haben. Die hatten aber noch keine Verbindung zum Internet. Und E-Mail hatte man auch noch nicht. Der Austausch mit den Kunden fand im wesentlichen per Telefon statt, bestenfalls per Fax. Alle Informationen hat man per Brief mit gedruckten Broschüren verschickt. Dann fing es an, dass sich analoge und digitale Welt vermischten, z.B. mit Immobilienscout. Die arbeiteten anfangs, als kaum jemand eine E-Mailadresse hatte, noch so, dass sie die Exposés zu Objekten rausgefaxt haben an die Interessenten …
H von G: Die Digitalisierung brauchte wagemutige Investoren, die an das Potential der neuen Technologien glaubten. Wann gab es denn im Immobilienbereich in Deutschland die ersten größeren Investments in die Online-Vermarktung?
TH:
[su_quote cite=““]Ich werde nie eine Immobilie über das Internet verkaufen. [/su_quote] – das habe ich nicht nur einmal von Bauträgern gehört. Um 2000 arbeitete ich schon bei einem Start-Up: PlanetHome. Deren Gründungsgeschichte ist durchaus typisch für den fundamentalen Wandel, der sich damals vollzog: Sie sind aus der HVB-Immobilien hervorgegangen, einer klassischen Bankentochter. Dann hat ein Unternehmensberater dem Vorstand der HVB ein Konzept zur Online-Vermarktung von Immobilien präsentiert. Bis heute hält sich die Geschichte, dass das Meeting damit endete, dass sich die Vorstände nach der Präsentation ansahen und ihn fragten: Würden sie das denn auch für uns umsetzen können? Anschließend wurde ein Budget im hohen zweistelligen Millionenbereich zur Verfügung gestellt und der Unternehmensberater, der bis dahin nur beraten aber nie umgesetzt hatte und darüber hinaus kaum über Praxiserfahrung im Bereich der Immobilienvermarktung verfügte, bekam mehr oder weniger freie Hand. So wurde PlanetHome gegründet – und die gibt es heute noch. Die Jahre um 2000 waren schon die Zeit, in der aus heutiger Sicht die Claims abgesteckt wurden. Und in der auch schon einige Große mit viel Geld unterwegs waren.
H von G: Nehmen wir noch einmal Immobilienscout, das ja bis heute das bekannteste Portal ist. Sind in seiner Entwicklung nicht auch die Konjunkturen der Immobilienbranche in den beiden vergangenen Jahrzehnten ablesbar?
SH: Ja, ich denke schon. Ein Marktplatz bildet Angebot und Nachfrage ab – und beides hat sich sehr verändert. In Berlin beispielsweise fokussierte sich bei Immoscout in den 2000er-Jahren alles auf Altbauten und auf den Osten. Neubauten gab es kaum, und die City-West spielte eine viel geringere Rolle.
TH: Der Aufstieg der Online-Portale lief in Berlin zeitlich parallel mit dem Ende des Berlin-Hypes der Nachwendezeit – als man noch dachte, dass Berlin in Kürze fünf Millionen Einwohner haben würde. Ich bin am 1. Januar 2000 nach Berlin gekommen, um hier Neubauwohnungen zu vermarkten, aber da hatte ich mir die falsche Stadt und den falschen Moment ausgesucht …
SH: Da kamst Du entweder zwei Jahre zu früh. Oder zwei zu spät …
TH: Genau. Es gab 2000 praktisch keine Geschosswohnungs-Neubauten in Berlin. Ich erinnere mich an einen Grundstücksmarkt-Bericht des Gutachterausschusses aus dem Jahr 2004 oder 2005, in dem zu lesen war, dass in einem ganzen Jahr in Berlin ganze 165 Neubauwohnungen verkauft worden waren. Damals hatten wir zwei Stadtvillen im Grunewald mit 16 Wohnungen im Angebot. Damit hatten wir einen Marktanteil von 10 Prozent – das muss man sich mal vorstellen. Nur mal zum Vergleich: Heute werden in Berlin über 10.000 Wohnungen jährlich gebaut und verkauft. Diese Entwicklung hat aber erst 2010 begonnen, als der Markt richtig angesprungen ist.
H von G: Wie haben sich denn danach die Vermarktungswege in Ihrer Branche verändert?
SH: Der Wandel von Print zu digital ist auch der Wandel von Text zu Bild. Das wichtigste sind heute die Visualisierungen, die bildlichen Darstellungen eines Objekts. Wir merken, dass immer weniger gelesen wird. Dafür werden Bilder und auch Filme immer wichtiger. Das nächste ist jetzt die 360-Grad-Begehung, bei der man vom Rechner zu Hause verschiedene Wohnungen und Räume durchgehen und im Detail vergleichen kann.
H von G: Wird das von allen Kunden gleichermaßen genutzt?
SH: Grundsätzlich würde ich zwischen zwei Typen von Interessenten unterscheiden, die auch unterschiedliche Angebotsformate verlangen. Die einen wollen möglichst viele Informationen: zur Größe, zur Lage, zur Ausstattung usw. Wenn man ihnen all diese Informationen auf der Webseite liefert, kann das aber auch Nachteile haben.
H von G: Welche?
SH: Der Kunde trifft dann in der Regel eine einsame Entscheidung. Ich erfahre aber nicht, warum er sich für oder gegen das Objekt entschieden hat, ob er es wirklich verstanden hat. Der andere Typus ist jener, der sich nicht durch viele Informationen, sondern von einem tollen Rendering oder Foto ansprechen lässt und den Impuls bekommt, mehr wissen zu wollen, und dann anruft oder schreibt. Je höherwertiger eine Wohnung ist, desto wichtiger ist dieser persönliche Austausch.
H von G: Werden Anzeigen im Netz also nach dem Prinzip künstlicher Informationsverknappung gestaltet?
SH: Das ist nicht nur Verkaufsstrategie, sondern hat auch viel damit zu tun, dass Kunden heute andere Devices für ihre Suche nutzen. Früher saß man mehr zu Hause vor dem großen Monitor und konnte sich dementsprechend intensiver damit beschäftigen. Heute sieht man eher unterwegs auf dem Smartphone nach, was es auf dem Markt Neues gibt. 60 Prozent der Immobiliensuche werden heute mit dem Smartphone oder Tablet erledigt.
[su_quote cite=““]Und wer da vom Bild nicht angezogen wird, springt sofort weiter. [/su_quote]
H von G: Wie wichtig ist die eigene Firmenwebseite überhaupt noch als Vermarktungskanal?
TH: Die eigene Firmenwebsite ist nach wie vor eine Visitenkarte, oft die erste im Netz. Die sozialen Netzwerke haben allerdings an Bedeutung gewonnen. Wobei man dort noch viel weniger Zeit hat, um den Kunden anzusprechen. Die Struktur von Facebook, Instagram usw. ist so angelegt, dass die Nutzer dort nicht gezielt nach Immobilien suchen, sondern eher angeteasert werden.
SH: Das sehe ich auch so. Eine zunehmende Rolle spielen auch Plattformen wie Pinterest. Das ist ja kein Immobilienportal, sondern ein Ort, wo ich mich inspirieren lasse, wo ich Ideen sammle. Die steigende Bedeutung der sozialen Netzwerke geht damit einher, dass die Käuferschicht, zumindest in Berlin, jünger geworden ist.
H von G: Woran liegt das?
SH: Das sind verschiedene Faktoren: erstens die Erbengeneration, zweitens die Start-Up-Gründer, drittens die Tatsache, dass man jetzt auch in Berlin sehr gut bezahlte Jobs finden kann.
[su_quote cite=““]Und das sind nun alles Menschen, die mit Facebook, Instagram und Pinterest aufgewachsen sind. Und deren Erwartungshaltung ist: Hol mich da ab. [/su_quote]
H von G: Die jüngere Generation hat ja durch das Netz auch eine andere visuelle Vorstellungskraft entwickelt. Wer regelmäßig Ferienwohnungen bei Airbnb bucht, kann sich schon vorher vorstellen, wie eine Wohnung aussehen wird, die er nur von Bildern kennt. Brauchen solche bildkompetenten Menschen überhaupt noch eine klassische Wohnungsbesichtigung?
TH: Ich glaube, dass die Besichtigung des Projektes vor Ort und, sofern möglich, auch die Wohnungsbesichtigung mindestens für Eigennutzer weiterhin unverzichtbar ist. Nur so versteht man, wie der Kiez und die Wohnung funktionieren. Und ich glaube, das wird auch in 20 Jahren noch so sein.
H von G: Aber bei Neubau-Projekten in Städten wie München oder Berlin ist das doch in der Realität gar nicht möglich. Fast jede Wohnung ist ja verkauft bevor sie gebaut wird. Da sind wir wieder bei den Visualisierungen. Sind sie auch deshalb heute so wichtig? Weil die Käufer auch unter diesen Umständen eine gewisse Sicherheit haben wollen, wie ihr Haus oder ihre Wohnung aussehen werden?
SH: Ja, das stimmt. Das hat einen großen Einfluss. Die Leute interessiert beispielsweise immer der Blick aus ihrer Wohnung, was früher bedeutete, dass vor dem Kauf mindestens der Rohbau stehen musste. Heute ist es durch aufwendig produzierte Visualisierungen lösbar.
TH: Bis vor zwei oder drei Jahren haben wir bei Inventio dafür auch mit Architekturmodellen gearbeitet. Jetzt nutzen wir stattdessen 3-D-Modelle oder Brillen, Renderings aus verschiedenen Perspektiven und Luftbilder. In vielen Fällen ist das auch ein Ausprobieren und Testen. Und nicht alles, was heute erprobt wird, wird es in 10 Jahren noch geben.
H von G: Helfen die Visualisierungen auch bei der Bemusterung, also bei der Wahl von Fußbodenbelägen oder Badezimmerausstattungen?
SH: Absolut. Man kann alles wunderbar am Computer durchspielen. Will man den Parkettboden dunkel oder hell, welche Armaturen im Bad und so weiter. Früher musste man von einer Bad-Ausstellung zur nächsten laufen. Das wird jetzt bildlich dargestellt, man spart dadurch viel Zeit. Es kommt eine andere Dynamik rein.
TH: Das Prinzip kommt aus der Automobilindustrie. Da gibt es den Car Configurator. In der Immobilienbranche ist es jetzt der Flat-Configurator. Der Kunde wählt beispielsweise die „Puristische Linie“. Er bekommt er nach dieser Festlegung entsprechende Böden, Türklinken, Lichtschalter und so weiter angeboten, die er per Klick auswählt. Schließlich sieht er seine Wohnung in der von ihm ausgewählten Ausstattung. Zudem wird gleich noch angezeigt, wie viel Aufpreis für Sonderwünsche anfällt, weil z. B. irgendein Material gewählt wurde, das nicht zur Standardausstattung gehört. Im Moment ist das aber noch relativ aufwendig zu programmieren und macht erst ab einer gewissen Projektgröße Sinn. Trotz all dieser Entwicklungen haben wir im Büro immer noch einen Bemusterungsschrank, wo der Kunde die Materialien in Augen-schein nehmen kann. Das haptische Erlebnis oder Gefühl, eine Diele oder einen Naturstein anzufassen, das lässt sich immer noch nicht rendern. Aber die Kunden, die Wert auf diese Details legen, werden weniger.
H von G: Welche Rolle spielen Showrooms im Zeitalter digitaler Vermarktung?
TH: [su_quote cite=““]Wir kommen ja aus einer Zeit, wo der Verkäufer oder der Vertrieb in der klassischen Blechkiste auf der Baustelle gesessen hat. [/su_quote]Wenn er Glück hatte, war es ein verglaster Pavillon. Wenn er Pech hatte, war es halt ein Baucontainer. Und da fand dann alles statt. Draußen stand das Dixi-Klo. Mein Erweckungserlebnis, wie es anders laufen kann, war 2008 ein Projekt von Stofanel, die Wohnanlage „Marthashof“ in Berlin-Prenzlauer Berg. Die hatten als Showroom ein lilafarbenes UFO landen lassen, mit einer Fläche von etwa 300–400 Quadratmetern. Und dort haben sie für potentielle Käufer komplette Wohnsituationen abgebildet. Jeder Kleinwagen wird x-mal probe gefahren und mit der ganzen Familie begutachtet, bevor der Kauf vollzogen wird, aber für die Kaufentscheidung einer Eigentumswohnung hatten die Menschen früher oft nur ein paar bunte Bilder, einen Grundriss und eine Baubeschreibung, die meist schwer zu verstehen ist. In dem Showroom von Marthashof konnte sich der Kunde dagegen vorstellen, wie eine Wohnung, eine Küche, ein Bad konkret aussehen könnte. Zudem schafft es Vertrauen: Wenn der Bauträger in der Lage ist, einen solchen ambitionierten Showroom hinzustellen, dann besitzt er wohl auch die Kompetenz, das Gebäude zu errichten. Aus solchen Gründen haben wir zu jener Zeit unser früheres Budget für Print-Anzeigen nahezu komplett in Musterwohnungen und Showrooms, z. B. ab 2010 bei den Nymphenburger Höfen in München, und natürlich in Onlineportale umgelenkt.
H von G: Was macht einen guten Showroom aus?
SH: Er ist die Visitenkarte eines Projekts: Wird man nett empfangen, ist der Ansprechpartner kompetent, gibt es eine Spielecke für die Kids, so dass man sich ungestört unterhalten kann, im Warmen und ohne Zuhörer? All das strahlt positiv auf ein Projekt aus.
H von G: Welche Rolle spielen Musterhäuser und Musterwohnungen?
TH: Sie sind für viele Käufer Orientierungshilfen. Oft sagen Kunden in einer Musterwohnung sogar: Nehme ich. Genau so. Vorhänge drin lassen, alle Möbel stehen lassen. Die hätten sich das nie so eingerichtet. Aber in dem Moment, wo ein Profi das gestaltet hat und ein gewisser roter Faden beim Design zu erkennen ist, holt man die Leute ganz anders ab. Laien fehlt in diesem Bereich oft das Vorstellungsvermögen. Das funktioniert nicht im oberen Preissegment, dort haben die Käufer oft eigene Ideen, aber im mittleren Bereich doch erstaunlich häufig.
H von G: Wie verstehen Sie ihre Rolle gegenüber dem Bauträger?
TH: Das Markt-Know-How bringt ja zum großen Teil der Vertrieb mit. Bei Neubau-Projekten fragen die Bauträger viele Dinge bei uns ab: Wer ist die Zielgruppe? Wie ist der Wettbewerb? Wie soll der Wohnungs-Mix sein? Welche Kaufpreise kann ich erzielen?
SH: Und wie erreiche ich diese Zielgruppe …
TH: Das Markt- und Fachwissen des Vertriebes ist wichtig für den Projektentwickler, es beeinflusst die Planungsvorgaben an die Architekten maßgeblich. Genau deshalb beauftragen uns Bauträger und Projektentwickler: weil wir über das Jahr Hunderte von Kundengesprächen führen. Wir sind live dabei, wenn ein Paar sich den Grundriss anschaut und darüber diskutiert, ob das Wohnzimmer vielleicht doch größer sein sollte oder die Küche nicht offen. Natürlich ist die enge Zusammenarbeit mit dem Bauträger unser ureigenes Interesse: Wir wollen das Produkt gerne in einer Weise mitgestalten, die dazu beiträgt, es bestmöglich abverkaufen zu können.
H von G: Was wünschen Sie sich in der Zusammenarbeit mit Bauträgern und Projektentwicklern?
TH: Frühzeitig eingebunden zu werden, gerne schon in der Phase des Ankaufs eines Grundstücks. Dann können wir zur Konkurrenzsituation, zur Zielgruppe, zum Wohnungs-Mix recherchieren. Auf dieser Basis wird dann mit den Architekten das Produkt konfiguriert. Das hat nicht nur ökonomische, sondern auch psychologische Gründe: Wenn Du von Anfang an dabei bist, ist es auch dein Baby – und entsprechend stark identifizierst Du Dich damit. Ich wünsche mir Bauherren und Auftraggeber mit Mut zu guter Architektur. Weil ich glaube, dass Mut auch belohnt wird.
SH: Dem kann ich mich nur anschließen. Ich wünsche mir immer bessere Tools für eine umfassende Betreuung und Beratung des Käufers.
Weitere spannende Themen, zu unseren Projekten, Entwicklungen und Innovationen, finden Sie in unserem Buch
URBAN LEBEN. Melden Sie sich gerne für unseren Newsletter an und verpassen Sie kein Wohnungsangebot mehr!